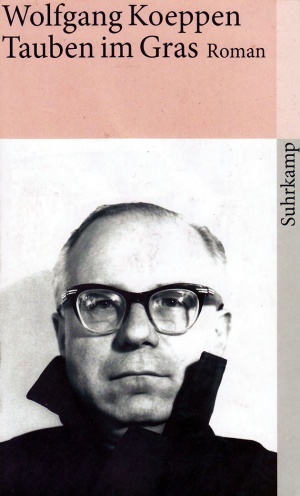Wolfgang Koeppen - Tauben im Gras
Verlag Suhrkamp
ISBN 978-3-518-37101-5
"Die Zeit" veröffentlicht im Sommer 2012 einen "Kanon der
europäischen Nachkriegs-literatur". Das hat mich auf den Gedanken
gebracht, meine Literatursammlung dieser Jahre wieder einmal
durchzusehen. Gestoßen bin ich auf "Tauben im Gras" von Wolfgang
Koeppen aus 1951, eine Lektüre, die - wie ich gerade erfahren habe -
glücklicherweise auch heute noch an deutschen Schulen durchgenommen und
damit nicht dem Vergessen anheim gestellt wird.
Auf dem Cover steht "Roman". Was uns erwartet, sind zahlreiche
kurze, kunstvoll geschachtelte Handlungs- und Seelenbeschreibungen ganz
verschiedener Menschen in einer zerbombten deutschen Nachkriegsstadt
(sehr wahrscheinlich diente München als Muster). Zunächst scheinen diese
kleinen Spots sich etwas wahllos und zufällig aneinanderzureihen, wobei
allerdings das Schlusswort des vorigen Absatzes oftmals zugleich das
Stichwort des neuen Kapitels ist und damit Zusammenhang stiftet. Erst
nach und nach erkennt dann der Leser, dass er es nicht etwa zu tun hat
mit einem bunten Strauß, einem Kaleidoskop zufälliger Lebensgeschichten,
sondern mit zunehmend sich schicksalshaft ineinander verwebenden
Handlungsfäden.
In großen Lettern sind - mitten im Text und ohne Trennungszeichen - die
aktuellen Nachrichten dieser Tage eingefügt. Aber auch das nicht
zufällig, sondern im sorgsamen Bezug zu den Ängsten und Sorgen der
handelnden Personen. Das hilft gerade dem heutigen jungen Leser, sich in
diese "schlimme" Zeit hineinzuversetzen. Nordkorea hatte
Südkorea angegriffen, Persien bedrohte die Welt, die ersten
aufrüttelnden deutschen Nachkriegsfilme (z.B. "Die Sünderin" mit
Hildegard Knef) erschienen, überall ist die amerikanische
Besatzungsmacht präsent, die allerersten deutschen Unternehmungen
etablieren sich, die Gewerkschaften stellen bereits Forderungen. Denn
das neue Geld ist da - aber eben auch die Angst vor einem neuen Krieg.
Bereits schon damals ging es nicht zuletzt um Ölressourcen.
Die Handelnden sind so unterschiedlich, wie solch ein Buch es eben
braucht: Die Millionenerbin, die alles verloren hat, vor allem das
"was-du-warst", zudem auch mit dem materiellen Verlust nicht
klar kommt und verbliebene Teile ihres Besitzes ins Pfandhaus trägt, um
zu überleben. Bereits wieder zu Geld gekommene und schon wieder
bohèmeähnlich lebende Filmschauspieler, die ihren Nachwuchs
vernachlässigen und in die Obhut einer frömmelnden, andauernd den
Gotteszorn beschwörenden Gouvernante geben. Schwarzmarkthändler,
Schieber, Schnorrer, Kriegerwitwen, Trinker und andere Abhängige,
Diebe, Falschspieler und Jugendgangs, weiße und schwarze Amerikaner,
letztere 1951 noch "Neger" genannt, die ersten amerikanischen
Touristen, Dirnen, Engelmacher und Doktoren.
Zunächst haben die agierenden Personen noch Namen. Die Frau, die der
weiße Amerikaner Richard zum Schluß kennenlernt wird dann aber nur noch
als das "Fräulein" bezeichnet. Wohl ein Hinweis darauf, wie
unbedeutend das einzelne Schicksal im Gesamtbezug ist.
Die alten Nazis sind noch, die neuen sind schon wieder da.
"Hauptrollen" - wenn man das überhaupt so nennen darf - spielen
ein deutscher Schriftsteller, dem die geistige Tinte ausgegangen ist und
ein berühmter amerikanischer Dichter und Philosoph, der zu Besuch in
München weilt und trotz aller Schrecklichkeiten den deutschen Geist
beschwört, seinen Deutschlandbesuch aber wahrscheinlich nicht überlebt.
Irgendwie fragt man sich, was hat sich eigentlich in der
Nachkriegsgesellschaft geändert?!
Der Leser spürt, wie sich die Wege der Handelnden nähern und
schicksalshaft aufeinander zulaufen, und zwar hin auf den Vortragsabend
im Amerikahaus und den Tagesausklang im benachbarten Soldatenclub. Die
Dinge kulminieren, obwohl alles an nur einem einzigen Tag im
Nachkriegs-München passiert. Aber warum hat es diese Menschen überhaupt
miteinander verwoben? Vielleicht gibt uns ein Zitat aus dem Buch eine
Antwort: "Wir verkehren miteinander, weil wir alle deklassiert
sind".
Das Buch ist voller verpasster Gelegenheiten, das scheint einer der
vorherrschenden Themenkontexte zu sein. Und niemand ist richtig froh,
alle tragen an ihren Schicksalen. Nur als der stolze schwarze
amerikanische Besatzungssoldat Odysseus Cotton eingeführt wird, lässt
der Autor ihn lachen, im scharfen Kontrast zu allen anderen Personen.
Und es gibt eine Reihe tragischer, ja skurriler Szenen. Etwa, als drei
Menschen, die sich suchen, in drei verschiedenen Ausschänken dicht
nebeneinanderstehen und sich dennoch nicht finden. Und als unter der
Bahre des erschlagenen Gepäckdieners ("das Leben beurlaubte ihn
nie") das von ihm verwahrte amerikanische Soldaten-Kofferradio zu
spielen beginnt. Oder als im Club die amerikanische Soldaten bier- und
weinbeseelt in die verjazzten, von einer ehemaligen deutschen
Militärkapelle angestimmten, von den Amis aber natürlich nicht
verstandenen urdeutschen Gröllieder einfallen und dabei aufstehen.
Ein "happy end" gibt es nicht, ganz im Gegenteil. Auch keine
sonstige Erlösung oder Patentanweisung. Auch kein Blick in die Zukunft.
Das wäre 1951 ja auch sehr gewagt gewesen. Also bleibt es bei der
beklemmenden Milieuschilderung einer Zeit, die wir heute wohl lieber
verdrängen würden. Doch sind diese Dinge wirklich schon eine Ewigkeit
her? Und ist ähnliches nicht auch heute noch täglich in den Nachrichten
zu sehen, wenn auch etwas weiter weg? Bevor wir wegschauen, sollten wir
uns lieber von Wolfgang Koeppen noch einmal diesen - wenn auch
unbequemen - Spiegel vor Augen halten lassen. Denn dann sehen wir, was
wirklich bleibt, wenn man uns alles Materielle und vielleicht auch noch
die engsten Bezugspersonen nimmt.
Und der Titel? Wohl eine Metapher für die Zufälligkeit unseres Seins und
Aufeinandertreffens. So wie einige Tauben wahllos nebeneinander im Gras
hocken, so zufällig lässt uns das Schicksal aufeinanderprallen, und das
- wie wir lernen - offenbar selbst in Friedenszeiten mit Todesfolge.
Zitat: "Vielleicht ist die Welt ein grausamer und dummer Zufall
Gottes". Oder ein anderes Zitat: "Eine Unendlichkeit
zusammengefügt aus allerkleinsten Endlichkeiten, das ist die Welt".
Mancher mag jetzt sicher heftig widersprechen, bitte sehr!
PS: Übrigens hat "Die Zeit" als deutschen Beitrag zur
europäischen Nachkriegsliteratur für die Jahre 1945 bis 1949 "Doktor
Faustus" von Thomas Mann und für 1950 bis 1959 "Die
Blechtrommel" von Günter Grass gewählt. Von solchen Werken können -
allerdings ungerechtfertigterweise - schon mal einige Tauben im Gras
verdeckt werden ...